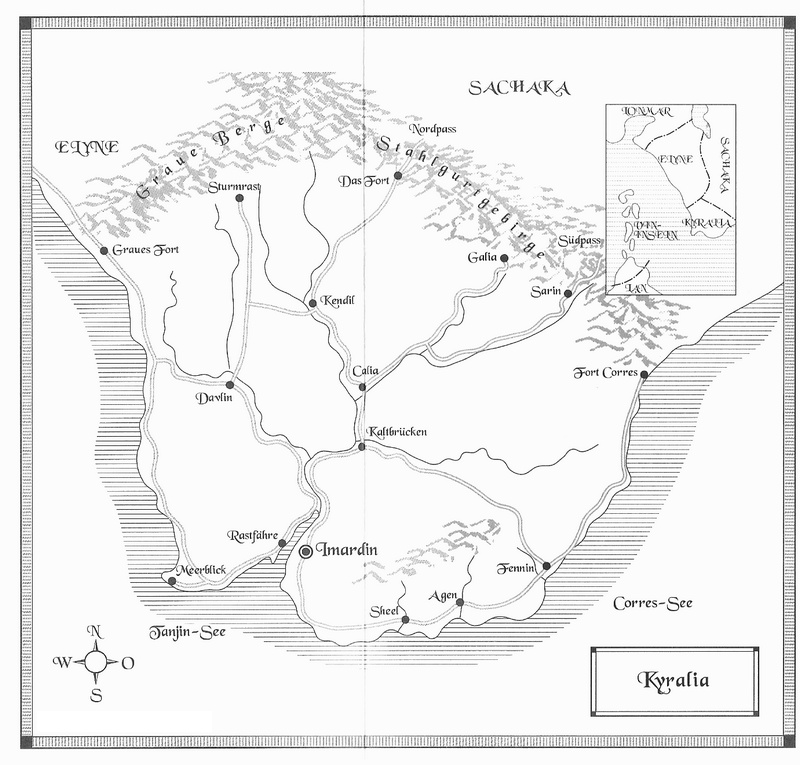Beim
letzten Mal
war die Namensgebung von Orten das Thema. Wir haben uns nach
Willovwale begeben, nach Immerwacht und in das Tal der Letzten Ernte
und ich habe versucht zu beantworten, warum Namen gleich nochmal so
verdammt wichtig sind. Im zweiten und vorerst letzten Teil von Über
das Schmieden von Welten will
ich einen genaueren Blick auf die Namensgebung von Charakteren werfen
und warum sie nicht nur wichtig, sondern auch ein großartiges Mittel
ist, der eigenen Welt Tiefe zu verleihen, ohne den Lesern seitenlange
Infodumps
zuzumuten.
Es beginnt mit einer Idee, vielleicht sogar mit einer ganzen Szene:
Ein Bauer sieht von der Feldarbeit auf, als er im Licht der untergehenden Sonne einen einsamen Wanderer erspäht. Seine erste Reaktion ist Furcht – das Land ist gefährlich, die Leute erzählen von Banditen, auch diesseits der Berge. Doch als der Mann näher kommt, sieht der Bauer, dass er zu gut gekleidet ist für einen Banditen. Eine lange Robe umhüllt seine Gestalt, die Stiefel sind fest und jedes Kleidungsstück ist mit Zeichen verziert, die der Bauer nicht lesen kann. Nicht, dass er sie lesen könnte, wenn sie in der Hohen Sprache geschrieben wären.
Es beginnt mit einer Idee, vielleicht sogar mit einer ganzen Szene:
Ein Bauer sieht von der Feldarbeit auf, als er im Licht der untergehenden Sonne einen einsamen Wanderer erspäht. Seine erste Reaktion ist Furcht – das Land ist gefährlich, die Leute erzählen von Banditen, auch diesseits der Berge. Doch als der Mann näher kommt, sieht der Bauer, dass er zu gut gekleidet ist für einen Banditen. Eine lange Robe umhüllt seine Gestalt, die Stiefel sind fest und jedes Kleidungsstück ist mit Zeichen verziert, die der Bauer nicht lesen kann. Nicht, dass er sie lesen könnte, wenn sie in der Hohen Sprache geschrieben wären.
Als
der Mann ihn schließlich erreicht, überwältigt Neugier seine
Furcht und der Bauer sieht auf, fragt: „Wer seid Ihr, Herr? Wie
lautet Euer Name?“
Der Wanderer lächelt. Seine Zähne sind weiß. „Du hast sicher von mir gehört“, antwortet er. „Mein Name ist …“
Und dann tut sich der Abgrund auf, nicht unter Bauer und Wanderer, sondern unter den Füßen des Autoren. Wie lautet der Name des mysteriösen Wanderers?
Es sieht immerhin stark danach aus, dass er eine wichtige Rolle spielen wird, vielleicht ist er einer der Hauptcharaktere, gar der Hauptcharakter. Da will ein Name wohlüberlegt sein, schließlich dürfen Leser und Autor seiner 300 bis 700 Seiten lang nicht überdrüssig werden. Aber das ist nicht das einzige Problem, denn für Charakternamen gilt, was auch für die Namensgebung von Orten gilt (Na ja, „gelten sollte“): Sie müssen zu anderen Namen in ihrer Nähe passen, es sei denn, sie sind Teil einer anderen Kultur. Aber auch dann sollte der Autor stets im Hinterkopf behalten, dass irgendwo da draußen noch andere Menschen mit dem selben kulturellen Hintergrund herumlaufen, die besser nicht John, Natascha und Sun Wen heißen sollten, es sei denn man plant, eine Satire über Namensgebungskonventionen in Fantasy-Büchern zu schreiben.
Wenn ich schreibe, bevorzuge ich es, im Internet nach Auflistungen von Namen zu suchen, die aus einer Kultur stammen, wie ich sie mir in etwa für den Schauplatz der jeweiligen Geschichte vorstelle. Das können germanisch-stämmige, irische und gälische Namen sein, aber genau so gut indische oder arabische. Habe ich einen gefunden, der mir zusagt, verändere ich ihn in der Regel ein wenig, schließlich ist die Fantasy-Kultur nicht deckungsgleich mit der aus der echten Welt. Außerdem achte ich darauf, dass die Namen nicht Teil einer Namensgebungstradition sind, die von einer historischen Figur ausgeht, wenn diese Figur nicht auch in der Welt der Geschichte existiert. Abraten würde ich in jedem Fall von Namengeneratoren, wie man sie ohne großen Suchaufwand dutzendfach im Internet findet. Abseits von speziellen Generierungsoptionen, wie sie beispielsweise der Fantasy Name Generator von rinkworks.com bietet, und damit die Einschränkung auf spezielle Kulturräume ermöglicht, führt Zufallsgeneration nicht gerade zu einheitlicher Namensgebung.
Der Wanderer lächelt. Seine Zähne sind weiß. „Du hast sicher von mir gehört“, antwortet er. „Mein Name ist …“
Und dann tut sich der Abgrund auf, nicht unter Bauer und Wanderer, sondern unter den Füßen des Autoren. Wie lautet der Name des mysteriösen Wanderers?
Es sieht immerhin stark danach aus, dass er eine wichtige Rolle spielen wird, vielleicht ist er einer der Hauptcharaktere, gar der Hauptcharakter. Da will ein Name wohlüberlegt sein, schließlich dürfen Leser und Autor seiner 300 bis 700 Seiten lang nicht überdrüssig werden. Aber das ist nicht das einzige Problem, denn für Charakternamen gilt, was auch für die Namensgebung von Orten gilt (Na ja, „gelten sollte“): Sie müssen zu anderen Namen in ihrer Nähe passen, es sei denn, sie sind Teil einer anderen Kultur. Aber auch dann sollte der Autor stets im Hinterkopf behalten, dass irgendwo da draußen noch andere Menschen mit dem selben kulturellen Hintergrund herumlaufen, die besser nicht John, Natascha und Sun Wen heißen sollten, es sei denn man plant, eine Satire über Namensgebungskonventionen in Fantasy-Büchern zu schreiben.
Wenn ich schreibe, bevorzuge ich es, im Internet nach Auflistungen von Namen zu suchen, die aus einer Kultur stammen, wie ich sie mir in etwa für den Schauplatz der jeweiligen Geschichte vorstelle. Das können germanisch-stämmige, irische und gälische Namen sein, aber genau so gut indische oder arabische. Habe ich einen gefunden, der mir zusagt, verändere ich ihn in der Regel ein wenig, schließlich ist die Fantasy-Kultur nicht deckungsgleich mit der aus der echten Welt. Außerdem achte ich darauf, dass die Namen nicht Teil einer Namensgebungstradition sind, die von einer historischen Figur ausgeht, wenn diese Figur nicht auch in der Welt der Geschichte existiert. Abraten würde ich in jedem Fall von Namengeneratoren, wie man sie ohne großen Suchaufwand dutzendfach im Internet findet. Abseits von speziellen Generierungsoptionen, wie sie beispielsweise der Fantasy Name Generator von rinkworks.com bietet, und damit die Einschränkung auf spezielle Kulturräume ermöglicht, führt Zufallsgeneration nicht gerade zu einheitlicher Namensgebung.
 |
| Einheitliche Namensgebung sieht anders aus |
Abgesehen davon: Namen sind schwierig, aber wenn man auf Generatoren angewiesen ist, stellt sich doch die Frage, wie weit es mit der Phantasie her ist.
Ein Nachtrag noch, zu der oben genannten Methode: Wenn man Echtwelt-Namen nutzt und/oder verändert, sollte man natürlich auch ein Auge auf die Bedeutung des Vorlagenamens haben. Das gilt besonders, wenn man sich sicher ist, den Namen schonmal gehört zu haben, oder es nur der Klang ist, der einem gefällt. Irgendwer hat einmal im Scherz angemerkt, dass irgendwo, in irgendeinem Fantasybuch eine Prinzessin Chlamydia auf ihren Ritter auf dem weißen Ross wartet. Solche unvorteilhaften Namen lassen sich gerade heute leicht vermeiden: vor der Verwendung einfach mal bei Google eingeben.
Gerade Fantasy leidet aber unter einer weiteren Namensgebungstradition: Jeder, der schonmal einem Elfen namens Alurifandiliesornel oder dem Drachen Su'ge'rakk'ag'han begegnet ist, darf jetzt die Hand heben.
Ja, Fantasy darf die Grenzen des Gewöhnlichen sprengen, soll das sogar tun. Aber ein Autor sollte auch an seine Leser denken, ebenso wie an die Arbeit, die er hat, oder die Unterbrechungen im Schreibfluss, die immer dann auftauchen, wenn er siebzehn Seiten zurück blättern oder sein Notizbuch hervorkramen muss um nachzusehen, wie dieser verfluchte schwarze Drache doch gleich noch hieß. Ich gehe aber jede Wette ein, dass mehr Leser bereit sind, ein Buch zu lesen, dessen Charaktere fremdartige, aber lesbare Namen besitzen. Besonders, wenn es sich nicht nur um eine Handvoll Charaktere handelt, sondern sämtliche Namen in einem Buch nicht unter sechs Silben bleiben. Und dann ist da noch die Sache mit den Apostrophen: Wie zur Hölle spricht man sie aus? Leser und Autor mögen sie vielleicht nur lesen, aber irgendwer in der dargestellten Welt muss sie auch mal aussprechen. Überhaupt, welche Bedeutung haben die Apostrophe? Auslassungen?
Su'ge'rakk'ag'han schütze uns!
Damit zusammenhängend möchte ich auch noch kurz auf Spitznamen eingehen. Gerade bei langen Namen bieten sie sich an - auch wenn ich vorschlagen würde, einen Namen eher direkt zu kürzen, anstatt ihn durch Spitznamen zu entschärfen - aber auch hier sollte der Autor Vorsicht walten lassen. Zu schnell wird aus einem Spitznamen der sprichwörtliche rostige Nagel an dem das Auge hängen bleibt, weil er endgültig aus der Kultur der dargestellten Welt herausfällt. Oder er wirkt einfach albern.
 |
| Cromsindwuir, Schlächter der Blutebenen, Sohn des Roten Königs - seine Freunde nennen ihn Cindy - Quelle: Blizzard Entertainment |
Was absolut vermieden werden sollte, sind Namen, die allzu deutlich Abwandlungen des Namens (oder Nicknames) des Autoren / der Autorin sind. In veröffentlichten Büchern begegnet man dem eher selten, aber gerade in der Amateurfantasy postet schonmal Anna eine Geschichte über Aenea, Königin der Welt. Egal wie die Qualität der Geschichte sich letztlich erweisen sollte, riecht damit oftmals schon die Überschrift verdächtig nach Mary Sue. Die Autorin / der Autor wird es in diesem Fall schwer haben, Leser davon zu überzeugen, dass sie / er und der Protagonist zwei völlig unterschiedliche Individuen sind.
Zuletzt sollten Namen auch immer zur Atmosphäre der Geschichte passen oder ihr zumindest nicht völlig zuwider laufen. Freddy macht sich in einer lovecraftschen Horror-Fantasy ebenso schlecht wie Fritz, Knochenkönig der Gefallenen Länder, oder Bluttrinker, der quirlige Barde.
Namen, lautet auch heute wieder das Fazit, können Geschichte(n) schreiben - oder sie im ersten Satz, im ersten Kapitel, nach drei Seiten, versenken. Hinzu kommt, dass Namen soviel mehr sein können als bloße Klebezettel, die uns Protagonist X von Charakter Y unterscheiden lassen können. Auch Personennamen ermöglichen eine Vertiefung der Handlungswelt, indem sie uns Ausblicke auf Kultur und Geschichte ermöglichen. Warum heißen so viele Männer in Immerwacht Baradan oder Baerdan? Na, weil der König, der bis zuletzt Widerstand gegen die Heere des Reiches von Drachenstein leistete, Baerardan hieß. Die kleinen Veränderungen sind hingegen Anzeichen, dass seitdem viel Zeit vergangen ist. Was sagt es uns, wenn die Frauen einer Generation Guinne oder Vhinne heißen, ihre Enkelinnen aber Kelia oder Maridia? Hat hier etwa eine neue Kultur dem Denken der Menschen ihren Stempel aufgedrückt? Eine neue Religion möglicherweise, in der Kelia die Tochter des Gottes war, der die Welt geschaffen haben soll, und Maridia eine Märtyrerin? Und was sagt es über einen Charakter aus, der in einer neuen Umgebung plötzlich nicht mehr bei seinem Geburtsnamen Varaidon gerufen wird, sondern Vardan, weil die Menschen in seiner neuen Heimat Probleme mit der Aussprache eines fremden Namens haben?
Auch auf die Gefahr hin, wie der George-R.R.-Martin-Fanclub zu klingen: auch was Namen angeht, versteht er sein Handwerk. Oft ist nachvollziehbar, wer mit wem verwandt ist, alleine auf Basis der Vornamen, oder ob ein Charakter aus Westeros stammt oder von jenseits des Meeres.
Auch Guy Gavriel Kay achtet auf Einheitlichkeit in der Namensgebung, hat aber natürlich auch den Vorteil, dass er echte Namen verwenden kann. In seinem Erstlingswerk - der Fionovar-Trilogie - wirkt das alles allerdings noch nicht so rund, was auch am, von der Echtwelt völlig entrückten Setting liegen kann, das stark tolkienesk angehaucht ist.
Mein Favorit ist aber sicherlich Glen Cooks Black Company-Saga. In der multikulturellen Einheit der Söldnertruppe passen die Namen stets zur Herkunft der Charaktere, was besonders in den späteren Büchern interessant zu sehen ist, die in einem pseudo-indischen Dschungelsetting spielen. Die meisten von Cooks Charakteren tragen jedoch Spitznamen und hier überzeugt Cook wirklich, was Namensgebung betrifft: in der Regel gibt sich kein Mitglied der Söldnerkompanie seinen Spitznamen selbst, was sich in Namen wie "Croaker" (Der Doktor, aber auch: Der Miesmacher), Big Bucket oder Sleepy niederschlägt. Andere Charaktere sind schon deshalb ehrfurchtgebietend, weil sie aus diesem Schema rausfallen. Raven möchte man nicht im Dunkeln begegnen, Silent trägt seinen Spitznamen zu recht und Lady .... nun, Lady ist ein Fall für sich.
 |
| Glen Cook - Chronicles of the Black Company - Copyright TOR Books |